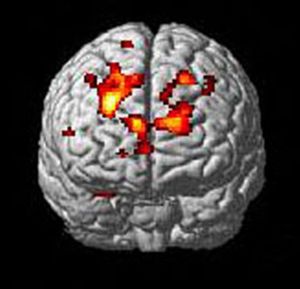News
"Wir müssen althergebrachte Klinik-Modelle überdenken": Prof. Bettina Pfleiderer über ihre Ziele als Präsidentin des Weltärztinnenbundes
Münster – Nur noch zwei Tage, dann wird Prof. Bettina Pfleiderer dem Weltärztinnenbund, dem größten internationalen Zusammenschluss von Medizinerinnen, als Präsidentin vorstehen. Der Zeitschrift „wissen.leben“ der Universität Münster gab die Leiterin der Arbeitsgruppe "Cognition & Gender" am Institut für Klinische Radiologie ein Interview über die Schwerpunkte ihrer bisherigen Arbeit sowie die Herausforderungen ihres künftigen Amtes.
In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit den kognitiven Fähigkeiten von Mann und Frau. Zieht sich das Thema "Gender" durch Ihr Leben?
Das ist Zufall. Meine Arbeit im Weltärztinnenbund und meine Forschung sind unterschiedliche Dinge. Ich setze mich für Ärztinnen ein, weil sich ihre Lage weltweit verbessern lässt. Meine Arbeitsgruppe forscht zu männlichen und weiblichen kognitiven Prozessen. Das ist alles, was mit Denken, Fühlen und mit dem Gedächtnis zu tun hat. Wir untersuchen, ob und inwiefern es Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt. Außerdem entwickeln wir Lehrmaterialien, damit Studierende verstehen, wie sich Erkrankungen bei Frauen und Männern unterschiedlich äußern.
Was ist der Weltärztinnenbund?
Er ist ein Zusammenschluss von vielen nationalen Ärztinnenverbünden. Er wurde 1919 in New York gegründet. Damals durften Frauen in vielen Ländern nicht Medizin studieren. Deshalb kamen viele in die USA. Doch das half nicht viel, weil beispielsweise indische Frauen trotz ihres Studiums in ihrer Heimat nicht praktizieren durften. Daraus entstand die Aufgabe, sich gegenseitig zu unterstützen.
Wie hat sich der Weltärztinnenbund entwickelt?
Inzwischen gehören fast 90 Länder dazu. Die Ziele sind ähnlich geblieben. Es ist ein Netzwerk, in dem sich Ärztinnen austauschen. Wir setzen uns auch für die Stärkung der Menschenrechte ein. Wir möchten beispielsweise die Gesundheitsversorgung von Frauen und Kindern weltweit verbessern und arbeiten ebenso an Maßnahmen zur Versorgung in Katastrophenfällen oder an Impfprogrammen mit.
Wie unterscheiden sich die Probleme der Ärztinnen in der Welt?
Es gibt Länder, in denen Frauen keine Rechte haben. Dort müssen wir uns anders einsetzen als in Europa. Hier geht es um die "Generation Y" und wie wir Arbeitsbedingungen für Ärztinnen so verbessern, dass sie ihre Arbeit und die Familie miteinander vereinbaren können. In Afrika geht es dagegen darum, dass Ärztinnen überhaupt als Fachkräfte akzeptiert werden.
Wie sieht es für Ärztinnen in Europa aus?
Alle reden von der Feminisierung der Medizin. Ich halte nichts von diesem Ausdruck. Natürlich sind 70 Prozent der Medizin-Studierenden Frauen. Deshalb besteht die Sorge, dass die medizinische Versorgung zukünftig schlechter wird, weil man denkt, dass Frauen in Teilzeit arbeiten und mit Teilzeitkräften keine gute Versorgung gewährleistet werden kann. Das ist nicht wahr. Außerdem kommt die sogenannte Ärztinnen-Welle erst in zehn Jahren. Wir haben also Zeit, um althergebrachte Klinik-Modelle zu überdenken. Die Generation Y betrifft zudem nicht nur Frauen. Das wird oft vergessen. Die Männer möchten auch nach Hause zu ihren Familien und nicht mehr zwei Tage am Stück arbeiten. Wir brauchen eine Reform, die beiden Geschlechtern zugutekommt. Ich finde diese Generation übrigens gut – sie haben nicht nur ihre Karriere im Blick, sondern das Leben.
Wie könnten diese Reformen aussehen?
Oberärztinnen könnten sich beispielsweise eine Stelle teilen. Das ist alles eine Frage der Organisation. Skandinavien organisiert bereits familienfreundlicher. Wir verlieren gut ausgebildete Fachkräfte, wenn wir nicht das Arbeiten in Kliniken ändern. Eine weitere Aufgabe wird sein, ausländische Fachkräfte in das Gesundheitssystem zu integrieren. An der Stelle kann der Weltärztinnenbund helfen, weil wir wissen, welche Bedürfnisse sowohl Behandler als auch Patienten aus anderen Kulturen haben.
Wie bereichert dieses interkulturelle Wissen Ihre Arbeit?
Ich habe viel über Kultur gelernt. Vieles, was über den Einfluss von Geschlecht auf Erkrankungen geforscht wird, kommt aus den USA. Diese Ergebnisse sind nicht immer übertragbar. Mann- oder Frausein bedeutet in jeder Kultur etwas anderes. Der Weltärztinnenbund kann auch hier helfen, beispielsweise internationale Forschungsinitiativen auf den Weg zu bringen, die untersuchen, welche Einflüsse wirken.
Quelle: wissen.leben, Ausgabe Dezember 2015
In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit den kognitiven Fähigkeiten von Mann und Frau. Zieht sich das Thema "Gender" durch Ihr Leben?
Das ist Zufall. Meine Arbeit im Weltärztinnenbund und meine Forschung sind unterschiedliche Dinge. Ich setze mich für Ärztinnen ein, weil sich ihre Lage weltweit verbessern lässt. Meine Arbeitsgruppe forscht zu männlichen und weiblichen kognitiven Prozessen. Das ist alles, was mit Denken, Fühlen und mit dem Gedächtnis zu tun hat. Wir untersuchen, ob und inwiefern es Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt. Außerdem entwickeln wir Lehrmaterialien, damit Studierende verstehen, wie sich Erkrankungen bei Frauen und Männern unterschiedlich äußern.
Was ist der Weltärztinnenbund?
Er ist ein Zusammenschluss von vielen nationalen Ärztinnenverbünden. Er wurde 1919 in New York gegründet. Damals durften Frauen in vielen Ländern nicht Medizin studieren. Deshalb kamen viele in die USA. Doch das half nicht viel, weil beispielsweise indische Frauen trotz ihres Studiums in ihrer Heimat nicht praktizieren durften. Daraus entstand die Aufgabe, sich gegenseitig zu unterstützen.
Wie hat sich der Weltärztinnenbund entwickelt?
Inzwischen gehören fast 90 Länder dazu. Die Ziele sind ähnlich geblieben. Es ist ein Netzwerk, in dem sich Ärztinnen austauschen. Wir setzen uns auch für die Stärkung der Menschenrechte ein. Wir möchten beispielsweise die Gesundheitsversorgung von Frauen und Kindern weltweit verbessern und arbeiten ebenso an Maßnahmen zur Versorgung in Katastrophenfällen oder an Impfprogrammen mit.
Wie unterscheiden sich die Probleme der Ärztinnen in der Welt?
Es gibt Länder, in denen Frauen keine Rechte haben. Dort müssen wir uns anders einsetzen als in Europa. Hier geht es um die "Generation Y" und wie wir Arbeitsbedingungen für Ärztinnen so verbessern, dass sie ihre Arbeit und die Familie miteinander vereinbaren können. In Afrika geht es dagegen darum, dass Ärztinnen überhaupt als Fachkräfte akzeptiert werden.
Wie sieht es für Ärztinnen in Europa aus?
Alle reden von der Feminisierung der Medizin. Ich halte nichts von diesem Ausdruck. Natürlich sind 70 Prozent der Medizin-Studierenden Frauen. Deshalb besteht die Sorge, dass die medizinische Versorgung zukünftig schlechter wird, weil man denkt, dass Frauen in Teilzeit arbeiten und mit Teilzeitkräften keine gute Versorgung gewährleistet werden kann. Das ist nicht wahr. Außerdem kommt die sogenannte Ärztinnen-Welle erst in zehn Jahren. Wir haben also Zeit, um althergebrachte Klinik-Modelle zu überdenken. Die Generation Y betrifft zudem nicht nur Frauen. Das wird oft vergessen. Die Männer möchten auch nach Hause zu ihren Familien und nicht mehr zwei Tage am Stück arbeiten. Wir brauchen eine Reform, die beiden Geschlechtern zugutekommt. Ich finde diese Generation übrigens gut – sie haben nicht nur ihre Karriere im Blick, sondern das Leben.
Wie könnten diese Reformen aussehen?
Oberärztinnen könnten sich beispielsweise eine Stelle teilen. Das ist alles eine Frage der Organisation. Skandinavien organisiert bereits familienfreundlicher. Wir verlieren gut ausgebildete Fachkräfte, wenn wir nicht das Arbeiten in Kliniken ändern. Eine weitere Aufgabe wird sein, ausländische Fachkräfte in das Gesundheitssystem zu integrieren. An der Stelle kann der Weltärztinnenbund helfen, weil wir wissen, welche Bedürfnisse sowohl Behandler als auch Patienten aus anderen Kulturen haben.
Wie bereichert dieses interkulturelle Wissen Ihre Arbeit?
Ich habe viel über Kultur gelernt. Vieles, was über den Einfluss von Geschlecht auf Erkrankungen geforscht wird, kommt aus den USA. Diese Ergebnisse sind nicht immer übertragbar. Mann- oder Frausein bedeutet in jeder Kultur etwas anderes. Der Weltärztinnenbund kann auch hier helfen, beispielsweise internationale Forschungsinitiativen auf den Weg zu bringen, die untersuchen, welche Einflüsse wirken.
Quelle: wissen.leben, Ausgabe Dezember 2015